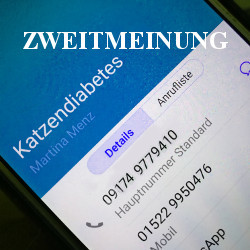ïŧŋ
ïŧŋ
Warum ist meine Katze dehydriert?
Welche InfusionslÃķsungen gibt es wofÞr?
Was benÃķtigt man fÞr eine Infusion?
Wie bereite ich eine Infusion vor?
Wie gehe ich bei der Infusion der Reihe nach vor?
Wie viel FlÞssigkeit sollte pro Tag verabreicht werden?
Was wenn meine Katze nicht still halten will?
Was passiert mit der restlichen InfusionsflÞssigkeit?
Wo kann ich mir das Infundieren einmal ansehen?
Wie unsere Kunden uns beurteilen lesen Sie hier.
Warum ist meine Katze dehydriert?
Die Dehydrierung selbst ist keine Krankheit. Sie ist ein Symptom, welches bei anderen vorliegenden Erkrankungen wie z. B. Diabetes, Ketoazidose, Niereninsuffizienz, FIV- und FeLV, Durchfall oder sonstigen Infektionen auftreten kann. Auch viele ÃĪltere Patienten leiden unter einer leichten Dehydration.
Als ÃĪuÃere Anzeichen fÞr eine fortgeschrittene Exsikkose gelten ein schlechtes, struppiges Fell und eine derbe bis lederartige Haut. Katzenhalter kÃķnnen selbst ÞberprÞfen, ob ihre Katze ausgetrocknet ist, indem sie eine Hautfalte im Nacken anheben. Die Haut sollte sich, nach dem Loslassen, schnell wieder in die alte Position zurÞckbewegen. Bleibt die Hautfalte stehen oder bewegt sie sich nur allmÃĪhlich zurÞck, ist die Katze bereits stÃĪrker dehydriert. Eine exaktere Auskunft ergibt eine Blutprobe, die auch frÞhe Stadien der Exsikkose erfassen kann.
Die Ursachen fÞr die Austrockung liegen beim Diabetes mellitus vor allem in einem gestÃķrten Wasserhaushalt durch die OsmolaritÃĪt der mit dem Urin ausgeschiedenen Glukose. Diese bindet FlÞssigkeit und sorgt so fÞr eine vermehrte Urinausscheidung (Polyurie). Eventuell vorhandene KetonkÃķrper verstÃĪrken diesen Effekt noch. Dem Organismus geht auf diese Weise mehr FlÞssigkeit verloren, als er entbehren kann - es kommt zur Austrocknung. Eine Exsikkose ohne Therapie kann lebensgefÃĪhrlich werden.
Bei Niereninsuffizienzpatienten entsteht die Exsikkose durch das mangelnde VermÃķgen der erkrankten Nieren den Harn zu konzentrieren. Auch diese Patienten scheiden viel mehr FlÞssigkeit aus als ein gesundes Individuum. Der Durchfallpatient verliert die FlÞssigkeit mit dem Stuhl. Bei Infektionen kann der Wassermangel z.B. durch eine erhÃķhte KÃķrpertemperatur (Fieber) und verminderte Nahrungs- und Wasseraufnahme verursacht werden.
Abhilfe schaffen Infusionen. Hierbei muss man zwischen intravenÃķsen und subkutaneneFlÞssigkeitsgaben unterscheiden:
- IntravenÃķse Infusionen werden in eine Vene und somit unmittelbar in den Kreislauf gegeben. Durch die ErhÃķhung des Blutvolumens, welche bei zu schneller Gabe BlutdruckerhÃķhungen und eine beschleunigte Herzfrequenz verursachen, muss die Tropfgeschwindigkeit gut Þberwacht werden und sollte nicht mehr als einen Tropfen alle zwei Sekunden betragen. Eine langsamere Einstellung ist kein Problem. Die Infusion dauert deshalb relativ lange, bis zu mehreren Stunden. Der Patient muss fÞr diese Zeit stationÃĪr aufgenommen werden, was beim Diabetiker durch Stress meist zu erhÃķhten Blutzuckerwerten fÞhrt.
Subkutane Infusionen hingegen dauern nur fÞnf bis zehn Minuten. Die FlÞssigkeit wird hier als Depot unter die Haut gegeben, von wo sie allmÃĪhlich durch die winzigen KapillargefÃĪÃe in den Blutkreislauf transportiert wird. Wie schnell sich das Depot (eine "Beule") unter der Haut fÞllt, ist dabei vÃķllig irrelevant. Die KapillargefÃĪÃe transportieren die FlÞssigkeit ganz allmÃĪhlich in den Kreislauf - sie dienen als "NadelÃķhr". Die Tropfgeschwindigkeit darf deshalb bei einer subkutanen Infusion in beliebiger Schnelligkeit erfolgen - sogar im Strahl, was die Infusionszeit erheblich verkÞrzt. Subkutane Infusionen wirken durch die Engstelle der Blutkapillaren mit einer VerzÃķgerung von eins bis zwei Stunden.
Ein weiterer groÃer Vorteil liegt darin, dass Katzenhalter das Verabreichen einer subkutanen Infusion erlernt und selbststÃĪndig zu Hause durchgefÞhrt kÃķnnen. Gerade das ist fÞr Diabetespatienten, denen jeder Stress schadet, von groÃer Wichtigkeit.Subkutane Infusionen
- dauern nur wenige Minuten,
- wirken mit einigen Stunden VerzÃķgerung,
- sind fÞr den Kreislauf weniger belastend als intravenÃķse Gaben,
- kÃķnnen vom Tierhalter zu Hause durchgefÞhrt werden,
- ein stationÃĪrer Aufenthalt des Patienten ist nicht nÃķtig.IntravenÃķse Infusionen
- dauern bis zu mehrere Stunden,
- wirken sofort,
- dÞrfen aufgrund von mÃķglichen Kreislaufproblemen nur vom Tierarzt durchgefÞhrt werden,
- erzwingen einen stationÃĪren Aufenthalt des Patienten (Stress).Liegt kein akuter, lebensbedrohlicher Zustand vor bzw. kommt es nicht darauf an, ob die Infusion sofort oder mit etwas VerzÃķgerung wirkt, kann mit einer subkutanen FlÞssigkeitsgabe der gleiche therapeutische Effekt erzielt werden, wie mit einer intravenÃķsen Gabe.
Da Infusionen je nach Schweregrad der Austrocknung oder Erkrankung zweimal wÃķchentlich bis zu zweimal tÃĪglich angewandt werden mÞssen, ist die Verabreichung zu Hause die bessere und fÞr die Katze auf jeden Fall schonendere Alternative.
Voraussetzung ist jedoch ein herzgesunder Patient. Bei nur leichter Herzerkrankung werden Infusionen meist problemlos vertragen. Der Tierarzt muss jedoch informiert sein und der Behandlung zustimmen. Bei fortgeschrittenen, dekompensierter Herzerkrankung sollten die Infusionen nur nach Rat des Kardiologen und unter strenger Aufsicht erfolgen.
Welche InfusionslÃķsungen gibt es wofÞr?
Als InfusionsflÞssigkeit kommen drei LÃķsungen in Frage:
- Isotone KochsalzlÃķsung (NaCl 0,9 %)
NaCl-LÃķsung wird vor allen Dingen verwendet, wenn die Katze z. B. unter HyponatriÃĪmie oder HyperkaliÃĪmie leidet, was allerdings nicht hÃĪufig vorkommt.
Sollte die Katze aber Erkrankungen haben, bei denen eine Natriumzufuhr unerwÞnscht ist, (z. B. LungenÃķdem oder Herzinsuffizienz) ist von einer Substitution mit KochsalzlÃķsung abzuraten.
Sind die Elektrolyte des Patienten unbekannt, kann man NaCl-LÃķsung auch fÞr einige Zeit zur Infusion nutzen, da hierdurch relativ wenig Schaden entstehen kann. - Ringer-LÃķsung (Ri)
Als VollelektrolytlÃķsung ist Ringer-LÃķsung dem Blut sehr ÃĪhnlich. Sie gilt als StandardlÃķsung und wird eingesetzt, wenn die Serumelektrolyte (z.B. Natrium, Kalium, Bicarbonat usw.) innerhalb der Referenzwerte liegen.
Weiterhin ist RingerlÃķsung das Mittel der Wahl, wenn eine Natriumzufuhr nicht sinnvoll ist. Sie eignet sich somit auch bei HypernatriÃĪmie Herzinsuffizienz oder LungenÃķdem. - Ringer-Lactat-LÃķsung (Ri-Lac)
Ringer-Lactat-LÃķsung, durch verschiedene Mineralien und Laktat ergÃĪnzt, entspricht ebenfalls der Zusammensetzung des Blutes. Sie wird benutzt, wenn von einer ÃbersÃĪuerung des Blutes (Azidose) ausgegangen werden muss. So z. B. bei Durchfallerkrankungen.
Bei Tumorerkrankungen sollte kein Ringer-Lactat verwendet werden. Tumoren verursachen eine Umstellung des Stoffwechsels. Laktat wird deshalb in Tumorpatienten nicht mehr abgebaut, sondern wieder in Glukose umgewandelt (Corizyklus). Diese Reaktion aber lÃĪuft nicht von alleine ab, sondern benÃķtigt Energie. Am Ende steht eine negative Energiebilanz fÞr die Zelle. Mit anderen Worten, durch die Zugabe von Laktat hilft man dem Tumor beim Wachsen, wohingegen der Patient noch schneller an Gewicht verliert, bis hin zur Kachexie".
Das Gleiche gilt fÞr Lebererkrankungen und bei Diabetes, auch hier ist Ringer-LÃķsung ohne Laktatpufferung die bessere Alternative. Vor allem bei einer diabetischen Ketoazidose, darf keine Ringer-Lactat-LÃķsung verabreicht werden! Da bei einer Ketoazidose der Diabetes noch nicht optimal eingestellt ist, kann intrazellulÃĪr kaum Lactat verstoffwechselt werden. Die Verstoffwechselung von Lactat zu Bicarbonat aber muss funktionieren, andernfalls wird die Azidose noch verstÃĪrkt (Lactatazidose).
- Isotone KochsalzlÃķsung (NaCl 0,9 %)
Bei der Wahl der InfusionslÃķsung kommt es vor allem auf die Elektrolyte im Blut an. Sind diese Werte unbekannt, sollte NaCl verwendet werden.
Beim Diabetes und vor allem bei einer Ketoazidose darf kein Ringer-Lactat verwendet werden, da es die KetonkÃķrperbildung verstÃĪrken kann.
Im Handel sind Infusionsflaschen aus Glas und aus Plastik erhÃĪltlich. Bei Glasflaschen benÃķtigt man einen InfusionsstÃĪnder oder eine dazugehÃķrige Halterung. Glasflaschen haben den Vorteil, dass sie sich beim Heraustropfen der FlÞssigkeit nicht verformen und die Infusionsmenge leichter ablesbar ist. Plastikflaschen hingegen besitzen am Boden eine Ãse, so dass man sie mit Hilfe eines Hakens Þberall aufhÃĪngen kann. (Bild 1)
 |
 |
||
| An einem Haken aufgehÃĪngte Infusionsflasche | Butterfly-KanÞle |
Was benÃķtigt man fÞr eine Infusion?
Um zu infundieren, werden folgende Utensilien benÃķtigt. Sie sind beim Tierarzt oder in der Apotheke rezeptfrei erhÃĪltlich:
- InfusionslÃķsung,
- Infusionsset(Plastikschlauch mit Tropfkammer),
- normale SpritzenkanÞlen - 0,8 mm (grÞne Farbe) bis 1,0 (gelbe Farbe),
oder statt dessen, die fÞr AnfÃĪnger besser geeigneten Butterfly-KanÞlen - ebenfalls 0,8 mm (grÞn) oder 1,1 mm (elfenbein/beige) (Siehe Bild 2), - Haken zum AufhÃĪngen der Flasche
- Papiertaschentuch
ButterflykanÞlen haben den Vorteil, dass sie bei einer unruhigen Katze niemals tiefer als beabsichtigt eindringen kÃķnnen. Sie werden bis zum Anschlag subkutan eingefÞhrt und machen das Infundieren gerade fÞr AnfÃĪnger zu einer sicheren Sache. Bei normalen KanÞlen darf die Nadel nur etwa bis zur HÃĪlfte unter die Haut geschoben werden. Wer noch niemals eine Infusion verabreicht hat, oder eine unwillige Katze infundieren muss, ist deshalb mit den etwas teureren Butterflynadeln besser beraten.
Wie bereite ich eine Infusion vor?
- Zuerst wird die Flasche mit der InfusionslÃķsung in einen Topf mit warmen Wasser gestellt oder auf eine (nicht zu heiÃe) Heizung gelegt. Auch in der Mikrowelle kann die LÃķsung fÞr einige Sekunden erwÃĪrmt werden. HÃĪufig wird auch InfusionslÃķsung mit Raumtemperatur verwendet, aber lauwarme LÃķsung ist fÞr den Patienten angenehmer.
Bitte infundieren Sie Ihre Katze niemals mit frisch gekÞhlter LÃķsung aus dem KÞhlschrank oder im Winter aus einem ungeheizten Zimmer!
- Dann entfernt man eine HÃĪlfte vom doppelseitigen Folienverschluss der Flasche. Manche Flaschen haben auch einen Plastikring zum Abziehen. Der Gummi darunter kommt zum Vorschein. (Bild 3)
- AnschlieÃend wird das Infusionsset ausgepackt und die Schutzkappe am oberen Ende der Tropfkammer entfernt. Das spitze Ende, welches durch den Gummi der Flasche gedrÞckt wird, kommt zum Vorschein. Dabei darf der Teil, der zuvor durch die Schutzkappe bedeckt war und der Gummi der Flasche, nicht berÞhrt werden. Diese Teile mÞssen steril bleiben! Das EinfÞhren des Zapfens in die Flasche ist mit etwas Kraftaufwand verbunden. Der Zapfen muss bis zum Anschlag eingefÞhrt werden. (Bild 4)
- Nun wird der Schieberegler des Infusionssets am Schlauch ans untere Ende geschoben (von der Flasche weg) und geschlossen. Achtung: Der Schieberegler lÃĪsst sich nur im geÃķffneten Zustand am Schlauch verschieben. Ist das RÃĪdchen bis zum Anschlag geschlossen, sitzt der Regeler fest. (Bild 5)
- Als nÃĪchstes muss das kleine Ventil oben an der Tropfkammer geÃķffnet werden. (Bild 6) Es bleibt wÃĪhrend der Infusion geÃķffnet, damit kein Unterdruck entsteht und die LÃķsung flieÃen kann.
- Jetzt wird die Flasche auf den Kopf gestellt und die Tropfkammer leicht mit zwei Fingern kurzzeitig zusammen gedrÞckt und sofort wieder losgelassen (Pumpbewegung), bis sie sich ca. halb gefÞllt hat. Das ist wichtig, um wÃĪhrend der Infusion eine Kontrolle zu haben, ob und wie schnell die LÃķsung tropft. Die Tropfkammer darf deshalb niemals ganz gefÞllt werden. Steht sie hingegen leer, gelangt stÃĪndig Luft mit in den Infusionsschlauch. (Bild 7)
- Als nÃĪchstes wird die Nadel (egal ob Butterfly oder KanÞle) am unteren Schlauchende des Infusionssets angeschlossen (eine viertel Drehung). Auch hier mÞssen die Verbindungsteile vor dem Zusammenbau steril bleiben, dÞrfen also nicht angefasst werden oder auf eine unsterile Unterlage gelegt werden.
- Dann Ãķffnet man den Schieberegler wieder und wartet, bis sich der gesamte Schlauch mit der LÃķsung gefÞllt hat und sie unten herauslÃĪuft. Bei Butterflynadeln muss man dazu die sterile Schutzabdeckung der Nadel nicht entfernen. Sie hat eine Ãffnung, durch die das Wasser abflieÃen kann. Bei normalen KanÞlen muss die Schutzkappe entfernt werden. Die KanÞle muss dabei steril bleiben, d. h. sie darf mit nichts in BerÞhrung kommen.
- Sobald der Schlauch mit der LÃķsung restlos gefÞllt und ohne Luftblasen ist, wird der Schieberegler wieder geschlossen. Die Vorbereitung der Infusion ist nun beendet.

Bild 3: Gummistopfen der Infusionsflasche.
 |
 |
||
| AnschlieÃen des InfusionsgerÃĪts | Regler am InfusionsgerÃĪt |
 |
 |
||
| Halb eingestochener Dorn des InfusionsgerÃĪtes | Die Tropfkammer sollte etwa halb gefÞllt sein |
Wie gehe ich bei der Infusion der Reihe nach vor?
Egal ob Sie den Patienten auf dem Boden oder auf einer erhÃķhten, bequemeren Stelle, wie z.B. dem Tisch oder Sofa infundieren, wichtig ist, die Flasche in Reichweite, jedoch in erhÃķhter Position aufzuhÃĪngen. Ist die Katze sehr temperamentvoll, oder hat sie noch niemals eine Infusion bekommen, ist es anfangs einfacher zu zweit zu infundieren: Eine Person hÃĪlt die Katze fest und lenkt sie ab. Die andere bedient den Schieberegler und passt auf, dass die Nadel nicht aus der Haut herausrutscht. Kurzzeitig kann bei schwierigen Patienten auch das Einwickeln in eine Decke oder die Verwendung eines Untersuchungsbeutels (z.B. Buster-Vet-Untersuchungsbeutel) hilfreich sein. SpÃĪter, wenn der Vorgang fÞr fÞr Katze und Tierhalter bekannt ist, ist eine subkutane Infusion i.d.R. auch alleine mÃķglich.
Nach Entfernen der Schutzkappe fÞhrt man die Nadel subkutan (unter die Haut) ein. Infundiert wird, genau wie bei der Verabreichung einer Spritze, grundsÃĪtzlich nur in die Flanken, genauer gesagt zwischen Ellenbogen und Kniegelenk - mindestens jedoch 3 cm von der WirbelsÃĪule entfernt. Man kann die Injektionsstellen auch mit der Sattellage beim Pferd vergleichen - natÞrlich mit Ausnahme der WirbelsÃĪule.
Infusionen in den Nacken und den Bereich zwischen den SchulterblÃĪttern sind aufgrund der Fibrosarkomgefahr (bÃķsartiger Bindegewebskrebs) absolut tabu! Bitte gestatten Sie auch Ihrem Tierarzt keine Infusion in dieser Lokalisation! (Mehr Info hierzu unter: Wohin muss ich meine Katze spritzen?)
Die Nadel sollte immer parallel zur KÃķrperoberflÃĪche gehalten und ebenso eingefÞhrt werden. Niemals darf im 90°-Winkel zur Haut gestochen werden! Nur so ist sichergestellt, dass die KanÞle nicht in Muskeln eintreten kann, was sehr schmerzhaft fÞr den Patienten wÃĪre. Bilden Sie dazu ein Zelt mit den Fingern, bzw. eine Falte, in die Sie die Nadel in LÃĪngsrichtung einfÞhren, damit sie nicht am anderen Ende wieder herausragt. Ist die Nadelspitze relativ beweglich, liegt die Nadel subkutan und somit in richtiger Position. Beim EinfÞhren der KanÞle stechen Sie bitte kurz und beherzt zu. Ein kurzer, schneller Ruck ist fÞr den Patienten kaum schmerzhaft. Ein vorsichtiges, zÃķgerliches Bohren ertrÃĪgt niemand gern.
Butterflynadeln werden komplett bis zum Anschlag eingefÞhrt, normale SpritzenkanÞlen nur etwa zur HÃĪlfte, also ca. drei bis vier Zentimeter. Dabei sollte, wie es medizinisch heiÃt "dorsal-ventral" gestochen werden. Mit anderen Worten stechen Sie bitte vom RÞcken (lat. Dorsum) in Richtung Bauch (lat. Venter), also von oben nach unten. Denn sonst reiÃt die Schwerkraft des anhÃĪngenden Schlauches die KanÞle beim Loslassen der KanÞle von allein wieder heraus.
Sitzt die Nadel, was nach etwas Ãbung innerhalb von Sekunden geschieht, wird der Schieberegler geÃķffnet und die Infusion beginnt. Bei den ersten Infusionen sollten Sie - oder Ihr Partner - den Patienten dabei gut festhalten. Die anflutende FlÞssigkeit erschreckt manche Katzen, so dass sie sich mit einem Satz entfernen mÃķchten.
Sollte die InfusionslÃķsung anfangs nur sehr langsam oder gar nicht tropfen, genÞgt oft schon eine leichte Bewegung an der Nadel (anheben, etwas zur Seite drÞcken, zwei, drei Millimeter herausziehen oder etwas tiefer stechen). Falls das nichts hilft, wurde mÃķglicherweise intrakutan (Nadelspitze innerhalb der Hautschichten) gestochen. Die Nadel muss dann noch einmal neu plaziert werden.
Je nach Tropfgeschwindigkeit dauert eine Infusion normalerweise ca. 5 Minuten. Da sich die Katze wÃĪhrend dieser Zeit so wenig wie mÃķglich bewegen sollte, kann es sinnvoll sein, die Infusion nach einer Mahlzeit vorzunehmen, wenn sie satt und trÃĪge ist oder schlÃĪft. Auch das Infundieren wÃĪhrend der Nahrungsaufnahme hat sich bei einigen Patienten bewÃĪhrt. Sie sind dann abgelenkt und registrieren die Infusion nicht.
Ist die gewÞnschte Menge verabreicht, wird der Schieberegler erst geschlossen und dann die Nadel entfernt. Mit einem Papiertaschentuch kann man die zum Teil wieder austretende FlÞssigkeit aufnehmen. Wurde ein BlutgefÃĪà verletzt (was ab und zu passieren kann und vÃķllig ungefÃĪhrlich ist), kann die Stichstelle auch etwas nachbluten. Die Blutung kommt innerhalb kurzer Zeit von allein zum Stillstand.
Eine andere Methode, dem Patienten schnell die notwendige Menge an FlÞssigkeit zukommen zu lassen, ist der Einsatz einer groÃvolumigen Spritze (z.B. mit 20 ml Volumen). Diese bekommt man auf Anfrage vom Tierarzt oder in der Apotheke. Auch hier ist auf den richtigen Sitz der KanÞle (subkutan, nicht intramuskulÃĪr oder intrakutan) zu achten. Und auch hier lÃĪsst es sich zu zweit besser arbeiten als allein. Allerdings reicht eine Injektion hier nicht aus und der Druck unter der Haut nimmt hier wesentlich schneller zu, was fÞr die Patienten meist unangenehmer ist.
Wie viel FlÞssigkeit sollte pro Tag verabreicht werden?
WÃĪhrend einer Infusion sollte fÞr eine normalgewichtige Katze (4 bis 6 kg) ca. 80 ml bis 100 ml verabreicht werden. Nur in schweren FÃĪllen (z. B. bei hochgradig verÃĪnderten Nierenwerten) sollte die Menge erhÃķht werden. Die Menge und HÃĪufigkeit sollten immer mit dem Tierarzt abgesprochen werden. Eine Skala an der Infusionsflasche verrÃĪt, wie viel infundiert wurde. Wem das zu ungenau ist, kann sich mit einer Infusionswaage behelfen. Eine FlÞssigkeitsdepot ("Beule") unter der Haut von ca. 8 cm Durchmesser (ohne Haare gemessen) entspricht ebenfalls in etwa dieser Menge.
Was wenn meine Katze nicht still halten will?
Sollte die Katze beim ersten Versuch einer Infusion zu Hause unkooperativ sein, ist das kein Grund sofort wieder aufzugeben. Hier gelten die gleichen Regeln wie beim Hometesting schon erwÃĪhnt (Was soll ich tun, wenn meine Katze nicht still halten will?) Manche Katzen sind anfangs verunsichert, wissen sie doch nicht, was noch geschehen wird. Die meisten aber gewÃķhnen sich schon nach kurzer Zeit daran.

Kater Poose z.B., mit dem ich, Martina Menz, - damals noch als Laie/lange vor meinem Studium - das Infundieren lernte, schlief nach einer kurzen EingewÃķhnungsphase einfach weiter... Allerdings habe ich damals zu weit vorn infundiert. Das FlÞssigkeitsdepot sollte besser hinter dem Schulterblatt, nach caudal (Cauda lat. Schwanz) verschoben sitzen.
Wichtig ist, dass die Katze keinen Erfolg mit einer eventuellen anfÃĪnglichen Abwehr hat. Lernt sie erst einmal, dass Gegenwehr zum gewÞnschten Ergebnis fÞhrt, hat der Halter auf lange Sicht keine Chance. Die meisten Katzen lassen sich nach einer EingewÃķhnungszeit problemlos infundieren. Ohne Infusionen hat eine dehydrierte oder auch nierenkranke Katze auf Dauer keine Chance!
Was passiert mit der restlichen InfusionsflÞssigkeit?
Die angebrochene Infusionsflasche kann jederzeit weiter verwendet werden, solange sich die FlÞssigkeit nicht trÞbt oder sonstig verÃĪndert. LÃĪnger als zwei, hÃķchstens aber drei Wochen sollte sie jedoch nicht genutzt werden. Dass fÞr jede Infusion eine neue sterile Nadel verwendet werden muss, versteht sich von allein. Das Infusionsset (Plastikschlauch und Tropfkammer) wird mit jeder neuen Flasche gewechselt. Eine Aufbewahrung der angebrochenen Flasche im KÞhlschrank ist nicht notwendig.
Auch bei Zimmertemperatur kann die LÃķsung vor dem Infundieren noch einmal aufgewÃĪrmt werden. Geschieht dies im Wasserbad, ist unbedingt zu beachten, dass das Ventil der Tropfkammer niemals mit dem unsterilen Wasser im Topf in BerÞhrung kommt. Sollte unsteriles Wasser in die Tropfkammer eindringen, wird die gesamte InfusionslÃķsung damit unbrauchbar. Das noch kalte Wasser aus dem Schlauch kann jeweils vor Beginn abgelassen werden.
Wo kann ich mir das Infundieren einmal ansehen?
Wenn Sie selbst noch nie infundiert haben, lassen Sie sich diesen Vorgang am besten einmal kurz von Ihrem Tierarzt zeigen. Da auch viele andere Katzenhalter ihre Tiere infundieren, ist es auch mÃķglich, sich dort Hilfe zu suchen.
Leider raten einige TierÃĪrzte prinzipiell davon ab, zu Hause zu infundieren. Einige trauen es dem Tierhalter nicht zu, andere bangen um ihre Einnahmequelle. In einem solchen Fall kann es nicht schaden eine zweite Meinung einzuholen, denn wenn der Halter selbst infundieren kann, erspart das dem Patienten viele stressige Tierarztbesuche.
Letzte Ãnderung 12.07.22